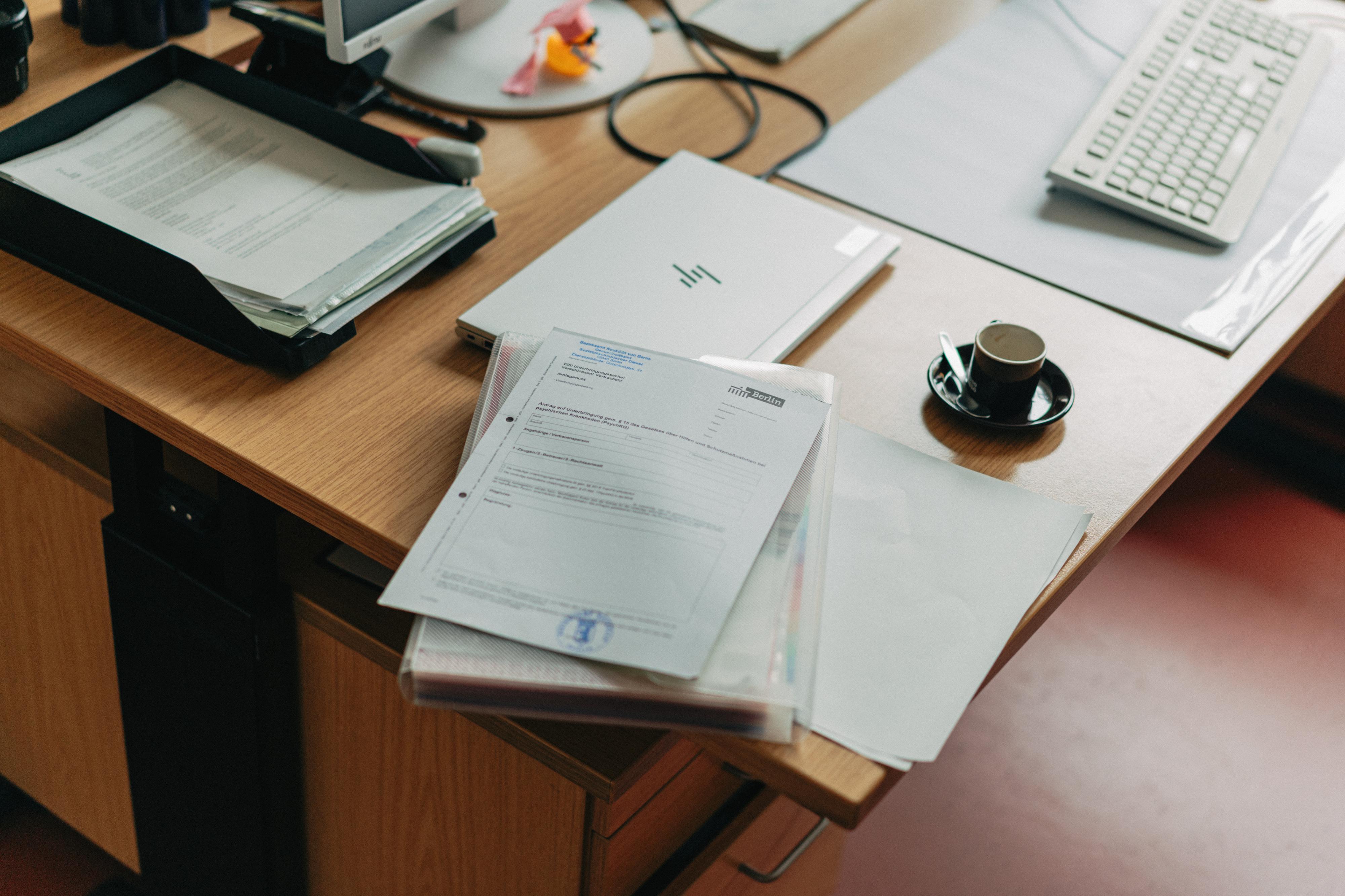Neulich kam er am helllichten Tag in eine abgedunkelte Wohnung. Eine Frau, die gerade ein Baby geboren hatte, rief an. Sie machte sich Sorgen um ihren Partner. Irgendetwas stimme nicht mit ihm. Er rede leise mit sich selbst, halte plötzlich Ramadan, obwohl er Christ sei. Als Andreas Grabner die Wohnung betrat, lag der Mann in der Badewanne. Starr wie eine Statue, mit offenen Augen, aber nicht wirklich da. “Als er aus seiner Welt auftauchte und einen Fremden vor sich sah, war er erst empört”, erzählt Andreas Grabner in seinem Büro. Doch er ließ sich darauf ein, in eine Klinik mitzukommen. Ganz freiwillig.
Für Andreas Grabner, 57, war dies ein gewöhnlicher Einsatz. Erstaunt hat ihn nur, dass seine Arbeit so leicht verlief.
Grabner ist Psychiater und leitet den Sozialpsychiatrischen Dienst in Berlin-Neukölln. Mit vier anderen Fachärzten, vier Psychologinnen und zwölf Sozialarbeitern kümmert er sich um Menschen, die psychisch sehr krank sind. Sie beraten in ihren Bürozimmern, am Telefon, per Mail – oder fahren raus zu Ausnahmesituationen. Manchmal begutachten sie dabei, ob jemand eingewiesen werden muss. Verletzt jemand sich selbst oder andere, auch gegen seinen Willen.
So wie vor wenigen Wochen. Ein Notruf. Der Mann von nebenan würde seine Möbel zertrümmern und Nachbarn im Treppenhaus aggressiv beschimpfen. Grabner, kurze Haare, Brille, Ohrringe, erzählt: Sie kamen zu zweit und mit der Polizei. Völlig außer sich stand der Mann, der an einer Psychose litt, inmitten von Scherben. Als er einem Beamten ins Gesicht schlug, wurde er fixiert. Handschellen, Trage, Klinik.
Drei Anrufe, zur gleichen Zeit
Gibt es psychische Erkrankungen, bei denen
Menschen zu einer Gefahr werden können? Diese Frage wurde in den
vergangenen Monaten immer wieder gestellt. Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Nach dem Angriff eines Kleinkindes in Aschaffenburg. Nach der Amokfahrt in Mannheim und der Messerattacke am Hamburger Bahnhof.
Alle
Täterinnen und Täter sollen nicht gesund gewesen sein – bei manchen wurde
konkret von einer Psychose oder Diagnose im Bereich der Schizophrenie
gesprochen. Alle waren der Polizei bekannt und drei waren
mindestens einmal auf einer geschlossenen Station gewesen.
Worüber nicht diskutiert wurde: Warum können Menschen wie Andreas Grabner Erkrankten oft weniger helfen, als sie möchten? Und wie kann die Politik die psychosoziale Versorgung in Deutschland verbessern?
Zunächst einmal ist erwiesen: Menschen mit psychischen Erkrankungen sind nicht per se gewalttätiger als Menschen ohne psychische Erkrankungen. Darauf weist zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde in einer Stellungnahme deutlich hin. Nur bei Suchterkrankungen oder in psychotischen Phasen sei das Risiko unter bestimmten Bedingungen und ohne eine Behandlung erhöht. Bei letzterem nehmen Betroffene die Realität anders wahr, können sich bedrängt oder verfolgt fühlen. Manchmal hören sie Stimmen, die ihnen Befehle erteilen. Möglicherweise zu Gewalt.
In Grabners Büro passiert an manchen Tagen nicht viel, an anderen müsste sich sein Bereitschaftsteam, bestehend aus zwei Personen, um drei Anrufe gleichzeitig kümmern. Dann wird überlegt: Was muss schnell die Feuerwehr oder Polizei übernehmen? Wo fahren wir selbst hin? Grabner muss priorisieren, denn er und sein Team haben kein Dienstauto, sondern fahren mit Bussen und Bahnen. So vergehen im Schnitt 30 bis 45 Minuten, bis die Mitarbeitenden bei Menschen ankommen, die zum Beispiel glauben, vergiftet zu werden.
Die Frau glaubte an Gase in ihrer Wohnung
Eine Frau, Mitte 30, wahnhafte Störung. Zweimal war Grabner bei ihr.
“Die Polizei meldete sich bei uns, weil sie ständig Strafanzeigen
stellte”, sagt er. “Angeblich würden mehrere Personen Gase in ihre
Wohnung einleiten, durch versteckte, kleine Schläuche.” Sie zeigte ihm,
wie sie Stellen im Laminatboden zugekleistert hatte. Auch dort kämen
bestimmt die Dämpfe hindurch.
Als Grabner ihre Vorstellung vorsichtig
infrage stellte, sollte er sofort gehen. Er reichte einen Antrag
beim Amtsgericht ein, für eine gesetzliche Betreuung, “weil sie
natürlich massive Probleme hatte”, sagt Grabner. Mehr konnte er nicht tun. Denn viele Menschen, die er besucht, seien zwar krank, aber halten sich für gesund.
Häufig würden sich deswegen auch nicht die Erkrankten selbst melden, sondern Angehörige oder Nachbarn. Der Mann schreit unten auf der Straße schon wieder seit Stunden herum! Die Frau von gegenüber hat heute Nacht dreimal geklingelt und wollte ein Kind retten, das wir angeblich gefangen halten würden! Alles schon passiert.
“Natürlich sind solche Umstände schwer auszuhalten”, sagt Grabner, “aber wenn Menschen bloß laut sind oder wirres Zeug erzählen, können wir kaum eingreifen.” Er könne mit der Person sprechen, Unterstützung anbieten, die meist abgelehnt wird, und den Fall im Blick behalten, falls erneut jemand anruft. Das war’s.
Wenn er wieder geht, schaut er in ratlose oder verärgerte Gesichter. “Muss denn erst etwas passieren? Diesen Satz hören wir ganz oft”, sagt Grabner.
Zu wenig Therapieplätze, zu volle Psychiatrien
Eine psychiatrische Behandlung kann in Deutschland nur freiwillig erfolgen – oder bei einer akuten und erheblichen Eigen- und Fremdgefährdung angeordnet werden. Die liegt zum Beispiel vor, wenn jemand versucht, sich selbst umzubringen, oder andere angreift. Doch selbst dafür braucht es in der Regel das Gutachten eines Psychiaters wie Grabner und einen richterlichen Beschluss.
“Wenn sich ein Mann über Jahre in seiner Wohnung verbarrikadiert, alle Fenster wegen angeblicher Strahlen mit Alufolie abklebt, aber friedlich ist, müssen wir ihn lassen”, sagt Grabner. Das gelte selbst bei Drohungen, auch gegen ihn. Einer
seiner “Klienten”, wie der Psychiater sie nennt, hat eine paranoide
Persönlichkeitsstörung. Immer wieder glaubte er an ein Komplott gegen sich – bis er das auch beim Sozialpsychiatrischen Dienst dachte. “Bei
solchen Störungen kann es schnell kippen. Gerade hat man sich noch gut
unterhalten – und plötzlich wird der andere wütend”, erzählt Grabner. Der
Mann schrieb ihm Mails. In einer stand, er solle aufpassen, wenn er
abends zur U-Bahn laufe. Grabner fürchtete nicht, dass wirklich etwas
geschehen würde. Doch ein paar Mal drehte er sich um.
Grabner mag seinen Job, weil er sich nie die Sinnfrage stelle. Obwohl so viele Menschen seine Hilfe brauchen, aber nicht wollen. Oder seine Unterstützung möchten, aber nicht bekommen können.
Niedergelassene Therapeuten können sich ihre Patienten aussuchen und die nehmen lieber den neurotischen Akademiker.
Laut der Bundespsychotherapeutenkammer warten Patienten in Deutschland durchschnittlich 20 Wochen auf den Beginn einer ambulanten Psychotherapie. Es gibt zu wenige Therapeutinnen und Therapeuten mit einem Kassensitz. Privatpraxen sind teuer. Das Kostenerstattungsverfahren, das manche von ihnen anbieten, ist ein langer, frustrierender Prozess, für den man sich sehr gut organisieren muss. Ähnlich heikel ist die stationäre Situation. Viele psychiatrische Kliniken sind laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft “dauerhaft voll ausgelastet” oder sogar überbelegt.
Deswegen versucht der Sozialpsychiatrische Dienst, sich mit einigen Praxen in Neukölln zu vernetzen, doch verlässliche Plätze gebe es noch nicht. “Niedergelassene Therapeuten können sich ihre Patienten meist aussuchen und die nehmen lieber den neurotischen Akademiker als jemanden, der von irgendwelchen Kameras erzählt”, sagt Grabner. Manchmal würde ein Psychologe aus seinem Team zwei-, dreimal mit den Menschen sprechen, aber das ersetze keine monatelange Therapie. “Mehr als Akutpsychiatrie geht eigentlich nicht”, sagt Grabner. Und so werden etliche sogenannte Drehtürpatienten in die Klinik gebracht, bekommen kurzfristig Therapien und eventuell Medikamente, werden entlassen und nicht weiter behandelt. Bis sie wieder eingewiesen werden.
Disclaimer : This story is auto aggregated by a computer programme and has not been created or edited by DOWNTHENEWS. Publisher: newsfeed.zeit.de